Der Aufsichtsrat der Badenova bewilligte in diesem Jahr 13 neue Innovationsfonds-Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt knapp 1,8 Millionen Euro. Über 500.000 Euro davon fließen in die Ortenau, die mit drei Projekten aus Offenburg, Achern und Freiburg/Rheinmünster Kreativität und Ideenreichtum beweist.
Die Innovationsfonds-Projekte für 2014 sind zwar über das gesamte Marktgebiet der Badenova verteilt, mit drei repräsentativen Projekten aus Offenburg, Achern und Freiburg/Rheinmünster ist die Ortenau jedoch stark vertreten. „Die Vielfalt der diesjährigen Projekte zeigt deutlich, wie erfindungsreich die Klimaschützer hier im Südwesten Deutschlands vorangehen“, lobt Badenova-Vorstand Mathias Nikolay die Projektpartner für 2014. „Alle Geförderten, mit denen wir dabei zusammenarbeiten, sind Energie-Pioniere – jeder auf seine Weise. Die Ortenauer sind hierfür ein gutes Beispiel.“
Offenburg – Biologische Methanisierung von Wasserstoff
Wind- und Sonnenenergie stellen einen wachsenden Anteil am deutschen Strommarkt. Beide Energiequellen sind jedoch stark wetterabhängig, so dass die Einspeisung ins Stromnetz zwischen Überschüssen und Unterversorgung schwankt. Stromspeicher können diese Schwankungen ausgleichen, sind aber noch nicht flächendeckend vorhanden. Im Vergleich zu anderen Speichern bietet das Erdgasnetz eine sehr hohe Speicherkapazität. Um elektrische Energie ins Gasnetz einzuspeisen, wird diese genutzt, um in einem elektrolytischen Prozess zuerst aus Wasser Wasserstoff zu gewinnen. Anschließend wird der Wasserstoff biologisch in Methan umgewandelt. Diese Technik ist jedoch bisher nur im Labormaßstab erprobt; die einzelnen Faktoren und beteiligten Mikroorganismen sind noch kaum erforscht. Das Projekt der Hochschule Offenburg untersucht diesen Prozess der biologischen Methanisierung ausführlich und analysiert, inwiefern sich Wasserstoff als Cosubstrat für Biogasanlagen eignet. Biogas entsteht in einer anaeroben Fütterungskette, in der sich aus Substrat – also Energiepflanzen, Grünschnitt oder Abfallstoffen – zuerst Kohlendioxid und Wasserstoff und schließlich Methan bildet. Rohbiogas enthält allerdings immer noch 30 bis 50 Prozent CO2, das aufwändig ausgefiltert werden muss, bevor das Biogas ins Erdgasnetz eingespeist werden kann. Durch Zugabe von zusätzlichem Wasserstoff aus Überschussstrom zum Gärprozess kann auch das restliche CO2 zu Methan umgewandelt werden. Um dieses bisher nur im Labormaßstab erprobte Verfahren der in situ-Methanisierung zu optimieren, erforschen die Offenburger Wissenschaftler unter anderem verschiedene Methoden, um den Wasserstoff in den Vergasungsprozess einzuschleusen, so dass er optimal durch die beteiligten Mikroorganismen, den Archaeen, verwertet wird, ohne diese zu beschädigen. „Mit unseren weitreichenden Erfahrungen in der Biogasforschung analysieren wir verfahrenstechnische, mikrobiologische, chemische und physikalische Aspekte der Methanisierung. Dabei setzen wir uns die Entwicklung eines Moduls zum Ziel, das nach Maßstabsübertrag in etwa 7000 deutschen Biogasanlagen integriert werden könnte.“, so Ulrich Hochberg, Professor im Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der Hochschule Offenburg. Das Projekt stellt so einen Lösungsansatz für zwei Problemfelder dar: Zum einen bietet es große Speicherkapazitäten für Überschussenergie, zum anderen macht es Biogasanlagen ökologisch und ökonomisch effizienter, indem es den Substratbedarf reduziert. Weil das mit Methan behandelte Biogas kaum noch CO2 enthält, entfällt auch die aufwändige Aufbereitung, bevor das Gas ins Erdgasnetz eingespeist werden kann. Der Badenova-Innovationsfonds unterstützt das Projekt, das von Januar 2014 bis Dezember 2015 läuft, mit 239.317 Euro.
Freiburg/Rheinmünster – Wirkungsgradsteigerung eines BHKW
Wie wirtschaftlich ein BHKW ist, hängt wesentlich von dessen elektrischem Wirkungsgrad ab. Wärmetauscher mit thermoelektrischen Generatoren können aus dem heißen Abgas des BHKWs zusätzlich Strom gewinnen und damit den Wirkungsgrad erhöhen. Thermoelektrische Generatoren wandeln Wärmeströme zwischen einer warmen und einer kalten Seite in elektrische Energie um. Sie sind robust, weitgehend wartungsfrei und langlebig, jedoch eignet sich ein Großteil der herkömmlichen Generatoren nur für Temperaturen bis 200 °C. So bleibt die Wärmeenergie aus dem Abgasstrom ungenutzt. Das Fraunhofer Institut für physikalische Messtechnik (IPM) hat in den vergangenen Jahren erstmals Module entwickelt, die sich für Temperaturen bis 550 °C eignen. Zusammen mit der Firma Schleif Automation aus Rheinmünster, spezialisiert auf den innovativen Anlagenbau, entwickelt das IPM einen thermoelektrischen Generator, der parallel zum vorhandenen Wärmetauscher die BHKW-Abwärme nutzt. Hierdurch kann neben der reinen Brauchwassererwärmung zusätzlich mit Hilfe des Wärmetauschers elektrischer Strom generiert werden. Das Projektteam simuliert zunächst das Verhalten des thermoelektrischen Wärmetauschers bei Betrieb im Abgasstrom eines BHKWs, um eine möglichst hohe Ausbeute an elektrischer Leistung zu erzielen. Danach wird ein eigens optimierter thermoelektrischer Wärmetauscher hergestellt und in einem von Badenova betriebenen Schleif-BHKW eingesetzt. Jan Horzella, Leiter des Projekts beim Fraunhofer IPM: „Wir rechnen damit, dass unser System den elektrischen Wirkungsgrad der BHKWs um etwa 2-3 % steigert.“ In Zukunft könnten solche thermoelektrischen Generatoren nicht nur in BHKWs, sondern auch in Fahrzeugen Verwendung finden und so weiter dazu beitragen, Treibstoff und CO2 einzusparen. Die Dauer des Projekts ist von Mai 2014 bis April 2016 angesetzt, der Badenova-Innovationsfonds fördert das Vorhaben mit 245.220 Euro.
Achern – Innovatives Mobilitätskonzept
Mit ihren 25.000 Einwohnern ist die Kreisstadt Achern ein wichtiges Einkaufszentrum für die umliegenden Schwarzwaldgemeinden und bis ins nahliegende Elsass. Acherns einzelne Ortsteile und die ländliche Umgebung jedoch sind nur schlecht an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Manche Ortsteile und anliegende Gemeinden fahren die Busse an Ferientagen gar nicht oder nur vereinzelt an. Das macht es für Menschen ohne eigenen PKW schwer, für Einkäufe oder Arzttermine ins Stadtzentrum zu kommen und erhöht die Anzahl individueller Fahrten von Autobesitzern. Deshalb erstellt die Stadt ein Mobilitätskonzept, das den Istzustand aufnimmt und anschließend ein abgestimmtes Maßnahmenpaket vorschlägt. Dazu analysierten die Planer die aktuellen Nahverkehrsangebote, die Verkehrsströme und die Nachfrage nach verbesserten und ausgeweiteten Buslinien. Wichtig war den Acherner Planern ein flexibles System, das sich vom starren Linienverkehr löst und die Kundenbedürfnisse optimal abdeckt. In der ersten Projektphase wurden so zum Beispiel mögliche Optionen wie Rufbusse und Ruftaxis analysiert. Auch ein ehrenamtlicher Bürgerbus für bestimmte Linien, wie er beispielsweise durch ein Innovationsfondsprojekt in Breisach bereits verwirklicht ist, wurde untersucht. „Erste Teilergebnisse zeigen, dass der Einsatz von Ruftaxis das bestehende Angebot ökologisch wie ökonomisch gut ergänzen könnte. Aus diesem Grunde verfolgen wir aktuell die konkrete Ausarbeitung dieser Variante.“, so Rainer Oberle, Leiter des Fachgebiets Hochbau und Bauverwaltung der Stadt Achern. Das Mobilitätskonzept hilft, den individuellen Autoverkehr zu vermindern und erhöht die Attraktivität der ländlichen Vororte und Bezirke. Während viele Städte klassische Stadtbussysteme aufweisen, ist Achern die erste kleinere Mittelstadt, die ihren Verkehr bewusst nach nachhaltigen und bürgerfreundlichen Kriterien in dieser Form neu organisiert. Im Anschluss an das Projekt können so auch andere Mittelstädte von den Acherner Erfahrungen profitieren. Der Innovationsfonds der Badenova bezuschusst das Vorhaben, das von Oktober 2013 bis Oktober 2014 dauert, mit 12.000 Euro.
„Die Ideen für das Jahr 2014 sind innovativ und gleichzeitig sehr realitätsnah. Viele haben zudem das Potential, wegweisend in ihrem Themenfeld zu werden. Genau darum geht es bei der Unterstützung des Innovationsfonds“, so der Projektleiter des Innovationsfonds Richard Tuth. Dass erfolgsversprechende Ansätze im Rahmen der Projekte sich nicht exklusiv für Badenova und den jeweiligen Projektpartner auszahlen, liegt in der Natur des Innovationsfonds: das Unternehmen stellt die Ergebnisse aus den Projekten nach Abschluss immer der Öffentlichkeit unter www.badenova.de/innovationsfonds zur Verfügung und verbreitet damit vorbildliche Verfahren, Technologien und Studienerkenntnisse aktiv weiter. Neben Bau-Konzepten und Anwendungen, Forschungs-, Studien- und Entwicklungsplänen sind auch Umweltkommunikations- und Pädagogik-Projekte in der breiten Palette der Förderobjekte vertreten. Zu den 2014 genehmigten Projekten zählen konkrete Vorhaben aus Weil am Rhein, Ühlingen, Freiburg, Offenburg, Umkirch, Teningen, Achern und Glottertal.
Innovationsfonds: Starthilfe seit 2001
Seit über zehn Jahren realisiert Badenova innovative Vorhaben mit dem Innovationsfonds. Jahr für Jahr verzichten die kommunalen Anteilseigener des Unternehmens auf drei Prozent des Unternehmensgewinns, um neuartige und ökologisch sinnvolle Klima- und Wasserschutz-Projekte mit Vorbildcharakter zu ermöglichen. Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Kommunen, Verbände, Vereine, Unternehmen und andere Organisationen. Vor der Mittelvergabe werden die Vorhaben durch einen unabhängigen Sachverständigenbeirat und einen Beirat aus kommunalen Vertretern geprüft. In letzter Instanz genehmigt der Badenova-Aufsichtsrat die Projekte.
Der Innovationsfonds hat in den vergangenen Jahren insgesamt rund 24 Millionen Euro an Fördermitteln für inzwischen 223 Umweltprojekte in der gesamten Region zur Verfügung gestellt. Der Zusatzeffekt: Die Projekte haben Investitionen in Höhe von rund 108 Millionen Euro im Umwelt- und Klimabereich in der Region ausgelöst. Vorstand Mathias Nikolay: „Wer beim Klimaschutz vorankommen will, muss auch experimentelle Technologien und unerprobte Ansätze verfolgen, die nicht in erster Linie durch Renditeerwartungen bestimmt sind. Mit dem Innovationsfonds geben wir zukunftsfähigen Ideen den nötigen Spielraum.“
(Presseinfo: badenova AG & Co. KG, Freiburg i. Br., vom 30.9.14)
Titelseite » Aus den Landkreisen » Textmeldung
Ortenaukreis - Offenburg
30. Sep 2014 - 15:05 UhrBadenova-Innovationsfonds für Klima- und Wasserschutz fördert: Ideenland Ortenau - Fördervolumen insgesamt knapp 1,8 Millionen Euro - Über 500.000 Euro davon fließen in die Ortenau
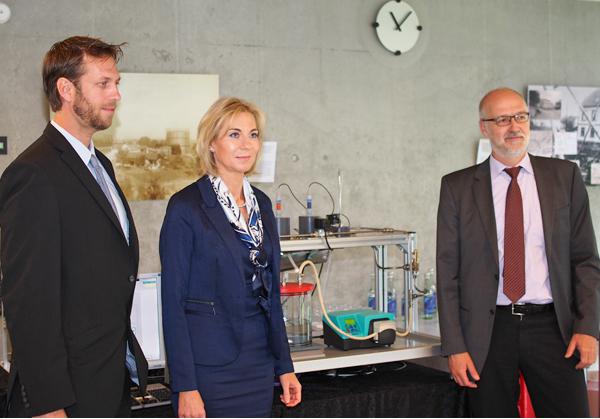
Die Referenten Dr. Kilian Bartholomé (Fraunhofer IPM), Prof. Dr. Christiane Zell (Hochschule Offenburg) und Dietmar Maier (Nahverkehrsberatung Südwest)
Weitere Beiträge von Medienmitteilung (03)
Jeder Verfasser einer Meldung (Firma, Verein, Person...) hat zusätzlich noch SEINE eigene "Extrazeitung" bei REGIOTRENDS! Oben auf den roten Namen hinter „Weitere Beiträge von“ klicken. Schon sehen Sie ALLE seine abrufbaren Meldungen in unserer brandaktuellen Internet-Zeitung.
weitere Bilder: Vergrößern? - Auf Bild klicken!


> Weitere Meldungen aus Offenburg. > Weitere Meldungen aus der Rubrik "Aus den Landkreisen". > Suche > Meldung schreiben P.S.: NEU! Sind Sie bei Facebook? Werden Sie Fan von RegioTrends! |
- Wir sind RegioTrends-Partner
-
 Metzgerei Linder
Metzgerei Linder
Talstr. 86, 79286 Glottertal, 07666-9447550 Kunstgalerie Messmer
Kunstgalerie Messmer
Grossherzog-Leopold-Platz 1, 79359 Riegel, Tel.: 07642/9201620 Bohrerhof
Bohrerhof
Zum Bohrerhof 1, 79258 Hartheim-Feldkirch | Telefon 07633 923320 | info@bohrerhof.de Winterhalder-Fenster-Türen-Tore
Winterhalder-Fenster-Türen-Tore
Otto-Lilienthal-Straße 9, 79331 Teningen, Tel. 07663/1743, Fax 07663/4608 1a Autoservice Morgenthaler/1a Sthil - Profi Morgenthaler
1a Autoservice Morgenthaler/1a Sthil - Profi Morgenthaler
Elzmatten 2a 79365 Rheinhausen, Tel. 07643 6122
und immer auch in den RegioMarktplatz-Rubriken! -



















- Regio-Termine
- Regio - Hier ist Platz für IHRE Veranstaltung! REGIOTRENDS-Service: Telefon 07641-9330919 - Weitere Termine im RegioKalender (Kategorie MAGAZIN)
- Emmendingen - Einkaufen, bummeln, erleben! - Mittwoch, 07. Mai 2025: Krämermarkt in Emmendingen
- Freiamt - 7. Mai: Theaterstück „Am Samstag kam das Sams zurück“ mit dem Theater Knuth in Freiamt - Aufführung im Kurhaus
- Müllheim - 8. Mai 2025 - Tag der Befreiung im Markgräflerland: Nie wieder Faschismus! - Einnerungen: Alter Friedhof in Müllheim am Donnerstag, 8. Mai 2025 um 18 Uhr
- Waldkirch - Einkaufen, bummeln, erleben! - Freitag, 09. Mai 2025: Krämermarkt in Waldkirch
- Freiburg - 9. Mai 2025: Europatag auf dem Münsterplatz in Freiburg - Glücksrad, Quiz, europäische Märchen und Aktionen für Groß und Klein
- Reute - Faszination Akkordeon in Reute gemeinsam erleben! - 10. Mai: Bezirkstreffen mit Wertungsspiel im Breisgau
- Emmendingen - Entertainment-Gala des Stadtmusikvereins Emmendingen - 10. Mai 2025 um 20:00 Uhr in der Steinhalle Emmendingen
- Kenzingen - 10. Mai 2025: Autorenlesung in Kenzingen - Veranstaltung mit Spiegel-Bestseller-Autor Tim Pröse im Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde St. Laurentius
- Broggingen - 11.05.2025: Wandertag und 2.Muttertagshock - Veranstaltung in Borggingen
- Waldkirch - 11. Mai 2025: Magie trifft Menschlichkeit in Waldkirch - Benefizshow mit THE MAGIC MAN am Muttertag in der Stadthalle
- Lahr - Irokesenbund und hierarchie-freie Demokratie | Vortrag von Klaus Schramm am Montag, 19. Mai 19 Uhr
- Winden - 25. Mai 2025: 11. Oldtimertreff des RMSV Soli Oberwinden e.V. im ADAC - Veranstaltung am Bahnhofsplatz mit anschließender Rundfahrt
- Offenburg - 24. Mai 2025: "Offenburg im 20. Jahrhundert, ein historischer Ausflug" - Vortrag bei Kultur in der Kaserne
- Bahlingen - Familien-Kaffeenachmittag am Sonntag, 25.5.2025, 14 Uhr, in der Silberberghalle Bahlingen - Lebenshilfe Emmenndingen und Landfrauen Bahlingen
- Offenburg - 30. Mai 2025: Salsa Dance Night in Offenburg - Veranstaltung bei Kultur in der Kaserne
- Freiamt - Freiämter-Spenden-Meisterschaft 2025 - Am 28.06.2025 steht Freiamt wieder ganz im Zeichen von Bike to help!!
- Tipps der Woche


- Wissenswertes
- Emmendingen - Schlosskeller Emmendingen: Kulturprogramm für Q2 in 2025 steht fest - Konzerte von Bands aus der Regio sowie von internationalen Musikern
- Emmendingen - ART-TRIO - Ausstellung im Schlosskeller Emmendingen bis Ende Juni 2025
- Emmendingen - 07.Mai.: Film-Club Breisgau trifft sich zum Clubabend im "Schlosskeller" in Emmendingen - Beginn: 20 Uhr
- Wyhl - Veranstaltungsreihe anläßlich des 50. Jahrestags der Platzbesetzung in Wyhl am Rhein - "Bürger helft euch selbst": Wyhl 1975 - ein Beispiel
- Emmendingen - SHG Autismus Landkreis Emmendingen: Nächstes Treffen erst am 08.05.2025
- Regio - Mit einem Klick zu den richtigen Adressen: Einkaufen (täglicher Bedarf, regionale Erzeuger) - Shopping (Mode, Wohnen, Geschenke…) - Dienstleistung (Recht & Finanzen, rund ums Haus…) - Gastronomie - Freizeit - Betreuung & Pflege - Schön, fit, gesund


- Klick-Service





















